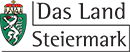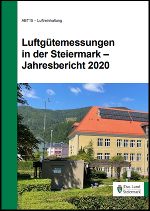Luftgütemessung Steiermark - Jahresbericht 2020
Im vorliegenden Bericht werden die auf Basis des Immissionsgesetzes Luft ausgewerteten Ergebnisse der im Kalenderjahr 2020 in der Steiermark durchgeführten Immissionsmessungen zusammengefasst und dargestellt. Weitere Inhalte dieser Jahreszusammenfassung sind der Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität (z.B. Luftreinhalteprogramm Steiermark 2019,) sowie weiteren Arbeitsschwerpunkten und Projekten des vergangenen Jahres gewidmet:
- Pig Air: wurde in Zusammenarbeit mit der HBLFA Raumberg-Gumpenstein und dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus initiiert um Ammoniakemissionen und damit Feinstaubimmissionen aus der Landwirtschaft zu reduzieren. Das vorrangige Ziel des Projekts war die Errichtung eines Versuchsstalls an der landwirtschaftlichen Versuchsanstalt Raumberg-Gumpenstein und dessen Ausstattung mit verschiedenen Technologien zur Abluftreinigung.
- Clean Air II: Auslöser für dieses Projekt war die Erkenntnis, dass die richtige Bedienung von Einzelöfen zu großen Einsparungen an Emissionen führen kann. Der Schwerpunkt lag auf dem Einsatz eines Trailers, der es den Besuchern ermöglicht, selbst zu versuchen, wie das eigene Verhalten die Luftschadstoffemissionen beeinflussen kann.
- Luftqualität in Stallungen-LUQUASTA: Das Projekt LUQUASTA (LuftQualitätStallungen) wurde nach 3-jähriger Laufzeit im Jahr 2020 abgeschlossen. In diesem Projekt wurden quantitativ und qualitativ Emissionen und Immissionen von Bioaerosolen im Umfeld von steirischen Tierhaltungsbetrieben erhoben.
- Weiterentwicklungen numerischer Ausbreitungsmodelle: Der Schwerpunkt der naturwissenschaftlichen Entwicklungen lag vor allem im Bereich der Anbindung des mesoskaligen Windfeldmodells GRAMM an globale Reanalysedaten (ERA5 Datensatz) des Europäischen Wetterdienstes ECMWF. Die mehr als zweijährige Entwicklungsarbeit im Referat Luftreinhaltung mündete in einer ersten Version des neuen Modellzweigs GRAMM-SCI (Grazer Mesoskaliges Modell - Scientific)
- BRAFA - Brandauswirkungen von Fahrzeugen mit alternativen Antriebssystemen: Das Verhalten derartiger Fahrzeuge im Brandfall - sei es im Zuge von Unfällen oder bei Defekten der Stromspeicher - war bisher weitgehend noch unerforscht. Diese Wissenslücke wurde im Zuge dieses Projektes geschlossen.
Das Jahr 2020 bilanziert aus Sicht der Luftgüte in der Steiermark, wie auch schon das Vorjahr, außerordentlich positiv. Neuerlich waren dafür neben dem allgemeinen österreichweiten Trend des Rückgangs der anthropogenen Emissionen, die Witterungsverläufe der immissionskritischen Wintermonate sehr hilfreich. Nach einem durchschnittlich belasteten Jänner blieben die Luftschadstoffkonzentrationen in sämtlichen nachfolgenden Monaten des Jahres sehr gering. Bei einigen Schadstoffen - insbesondere bei den Stickstoffoxiden - zeigten die zusätzlichen Emissionseinsparungen in Folge der Verkehrsreduktion während der coronabedingten Lockdowns im Frühjahr und Herbst nochmals einen deutlich positiven Effekt hinsichtlich der Schadstoffbelastung.
Für den Schadstoff Feinstaub PM10 konnten zum zweiten Mal hintereinander die Vorgaben der Europäischen Richtlinie 2008/50/EG über Luftqualität und saubere Luft für Europa [EG 2008] an allen steirischen Messstellen eingehalten werden, ohne dass Beiträge aus Winterdienst, natürlichen Quellen (Wüstenstaub) oder lokalen Baustellen statistisch berücksichtigt werden mussten. Auch die deutlich strengeren nationalen Vorgaben des Immissionsschutzgesetzes-Luft [BGBl 1997] konnten eingehalten werden, was in der Steiermark bis vor kurzem noch eher undenkbar erschienen war. Gleiches gilt für den Schadstoff Stickstoffdioxid NO2, wobei dies wie bereits erwähnt wohl maßgeblich auf die lockdownbedingt deutlichen Emissionsreduktionen in den entsprechenden Monaten zurückzuführen war. Die Ozonsaison dauerte vom Ende der ersten Aprildekade bis Mitte September und war damit vergleichsweise lang. Insgesamt blieben die gemessenen Werte im Jahr 2020 sowohl hinsichtlich der Maxima als auch der Grundbelastung (unter Heranziehung der Tage mit Zielwert-Überschreitung) deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 15 Jahre bzw. sogar am unteren Ende der Bandbreite.
An den regionalen Immissionsmustern und -unterschieden änderte sich in den letzten Jahren nur mehr wenig. Durch die Topographie der Steiermark, die eine deutliche klimatische und damit auch immissionsseitige Differenzierung bedingt, sind diese auch in Zukunft nicht zu erwarten. Ein gut durchlüfteter, gering belasteter alpiner Landesteil steht im deutlichen Gegensatz zu einem dichter besiedelten und damit höher belasteten südöstlichen Alpenvorland im Lee des Steirischen Randgebirges.
Der Großraum Graz blieb auch 2020 die höchstbelastete Region der Steiermark. Hier machen sich die Größe und Dynamik des Ballungsgebietes und die damit verbundenen Emissionen in einem im steirischen Vergleich merklich erhöhten Immissionsniveau bemerkbar. Trotz der günstigen Immissionen der Jahre 2019 und 2020 ist ein Umsetzen aller bewährten und neuer Maßnahmen notwendig, wenn auch weiterhin die Vorgaben der Luftqualitätsrichtlinie bzw. noch mehr des Immissionsschutzgesetzes-Luft für die Schadstoffe PM10 und Stickstoffdioxid eingehalten werden sollen.
Das Gratkorner Becken war auch 2020 wieder das einzige Gebiet im steirischen Messnetz, in dem zeitweise erhöhte Schwefeldioxidkonzentrationen registriert wurden, die ihren Ursprung in den Emissionen der lokalen Papier- und Zellstoffindustrie haben. Diese bewegten sich im langjährigen Vergleich aber mit Ausnahme zweier Einzelsituationen im August und im Dezember auf einem moderaten Niveau. Überschreitungen des Halbstundenmittelgrenzwertes nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft sowie der Zweiten Verordnung gegen forstschädliche Luftverunreinigungen [BGBl 1984] wurden an der Messstelle Straßengel Kirche registriert.
Schon seit einigen Jahren kann die Luftqualität in der Obersteiermark als generell sehr gut bezeichnet werden. Die gemessenen Primärschadstoffkonzentrationen blieben 2020 durchwegs und sehr deutlich innerhalb der Vorgaben des IG-L. Registrierte Überschreitungen des IG-L-Grenzwertes für PM10 waren auf eine Wüstenstaubepisode im März und nicht auf generell erhöhte Immissionen zurückzuführen. Auch in der ehemaligen Luftgüte-Problemregion Leoben-Donawitz wurden 2020 im Staub- und Schwermetall-Depositionsmessnetz (zentrale Mur-Mürz-Furche) vergleichsweise geringe Werte erhoben. Der IG-L-Grenzwert für die Gesamtstaubdeposition wurde lediglich an einem siedlungsrelevanten Messpunkt, dem Standort des Berufsförderungsinstitutes im Nahbereich des Eisen- und Stahlwerkes der VOEST, überschritten