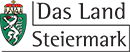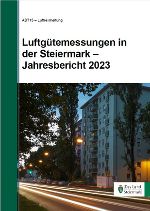Luftgütemessung Steiermark - Jahresbericht 2023
Im vorliegenden Bericht werden die auf Basis des Immissionsgesetzes Luft ausgewerteten Ergebnisse der im Kalenderjahr 2023 in der Steiermark durchgeführten Immissionsmessungen zusammengefasst und dargestellt. Weitere Inhalte dieser Jahreszusammenfassung sind der Umsetzung von Luftreinhaltemaßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzgesetzes - Luft sowie weiteren Arbeitsschwerpunkten und Projekten des vergangenen Jahres gewidmet.
Die positive Entwicklung bei der Belastung mit Luftschadstoffen setzte sich nach vier gering belasteten Vorjahren auch im Jahr 2023 in der Steiermark fort, was sich besonders in den Immissionen der Leitschadstoffe Feinstaub-PM10 und Stickstoffoxide zeigte.
Für den Schadstoff Feinstaub PM10 konnten zum nunmehr bereits fünften Mal hintereinander sowohl die Vorgaben der Europäischen Richtlinie 2008/50/EG über Luftqualität und saubere Luft für Europa [EG 2008] als auch die strengeren nationalen Vorgaben des Immissionsschutzgesetzes-Luft (IG-L) [BGBl 1997] an allen steirischen Messstellen eingehalten werden.
Bereits zum vierten Mal war dies auch für Stickstoffdioxid (NO2) der Fall. Hier konnte zum ersten Mal auch der IG-L Grenzwert (30 µg/m³) ohne Addition der derzeit noch gültigen Toleranzmarge (5 µg/m³) an allen Stationen eingehalten werden.
Trotz der durch die sinkenden Immissionen einhergehenden Abschwächung der früher so deutlichen räumlichen Differenzierung der Belastungen bleiben regionale Unterschiede. Der vergleichsweise gut durchlüfteten und entsprechend geringer belasteten alpinen Obersteiermark steht das meteorologisch benachteiligte und - da dichter besiedelt - auch von höheren Emissionen betroffene südöstliche Alpenvorland im Lee des Steirischen Randgebirges mit erhöhten Luftschadstoffkonzentrationen gegenüber. Aber auch in diesem Landesteil treten die ehemals flächigen Belastungen bei Feinstaub zunehmend in den Hintergrund und beschränken sich nunmehr auf kleinere Gebiete, wie es ansonsten nur bei den gasförmigen Luftschadstoffen der Fall ist.
Die höchsten Immissionen werden aufgrund der Siedlungsdichte und den damit verbundenen anthropogenen Emissionen in Verbindung mit der schlecht durchlüfteten Beckenlage weiterhin im Großraum Graz gemessen. Mit der Bilanz der Jahre 2019 bis 2023 ist aber die Zuversicht erlaubt, dass künftig ein durchgehendes Einhalten der Vorgaben der Luftqualitätsrichtlinie sowie des zum Teil strengeren IG-L unter normalen Bedingungen erwartet werden kann.
Nachdem sich die Mitgliedsstaaten, das Europäische Parlament und die Europäische Kommission im Februar 2024 auf neue, strengere Grenzwerte ab 2030 geeinigt haben, wird mit dem Inkrafttreten der Richtlinie aber erneut mit Überschreitungen in der Steiermark zu rechnen sein. Da insbesondere die Grenzwerte für die in den vergangenen Jahren problematischen Luftschadstoffe NO2 und PM10 und in Zukunft auch Feinstaub PM2.5 stark abgesenkt werden, werden Überschreitungen auch außerhalb des Großraums Graz, insbesondere im südlich anschließenden Unteren Murtal bis Bad Radkersburg sowie in manchen Bezirkshauptstädten der West- und Oststeiermark, zu erwarten sein.
Aufgrund der Emissionen aus der lokalen Papier- und Zellstoffindustrie war das Gratkorner Becken auch 2023 wieder die durch Schwefeldioxid-(SO2)-Immissionen am stärksten belastete Region des Landes. Die höchsten Konzentrationen wurden wie üblich an der Messstelle Straßengel Kirche in erhöhter Lage im Bereich der südlichen Beckenumrahmung registriert, wobei es am 4.5.2023 zu einer Grenzwertüberschreitung des IG-L Grenzwertes für den Halbstunden- mittelwert kam.
In der Obersteiermark blieben die gemessenen Schadstoffkonzentrationen auch im Jahr 2023 durchwegs und sehr deutlich unterhalb der Vorgaben des IG-L, das Niveau der Vorjahre konnte generell gehalten werden. Überschreitungen des Grenzwertes für den PM10-Tagesmittelwert blieben in einer sehr überschaubaren Größenordnung, was in diesem Landesteil aber schon seit rund elf Jahren der Fall ist.
Gegenläufig zum sonstigen Trend der Luftschadstoffkonzentrationen werden im Raum Leoben-Donawitz in der zentralen Mur-Mürz-Furche im Einflussbereich der lokalen Eisen- und Stahlindustrie keine Rückgänge der Staub- und Schwermetall-Depositionen verzeichnet. Der IG-L-Grenzwert für die Gesamtstaubdeposition wurde auch heuer wieder an mehreren siedlungsrelevanten Messpunkten überschritten.
Arbeitsschwerpunkte und Projekte im Jahr 2023:
- Luftreinhaltung und EU: Die stärker an die deutlich strengeren Richtwerte der WHO für die Partikelfraktionen PM10 und PM2.5 und für Stickstoffdioxid angeglichenen, ab 2030 vorgesehenen Luftqualitätsnormen berücksichtigen neben gesundheitlichen Auswirkungen noch weitere Aspekte für die politische Umsetzung und sollen der EU einen Pfad zur Erreichung des Null-Schadstoff-Zieles bis spätestens 2050 aufzeigen. Ende 2023 konnten die Trilog-Verhandlungen zwischen Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Europäischen Kommission gestartet werden. Nach erfolgreichem Abschluss wird die Einigung über die neue Richtlinie im Frühjahr 2024 erwatet. Da die ab 2030 geltenden Immissionsgrenzwerte derzeit noch deutlich überschritten werden, wird es die Aufgabe der nächsten Jahre sein, das Steiermärkische Luftreinhalteprogramm an die neuen Rahmenbedingungen anzupassen.
- Clean Air II: Im Jahr 2023 konnte das Demonstrationsprojekt, das der Bevölkerung durch Einsatz eines Trailers den richtigen Umgang mit händisch beschickten Holzöfen näherbringt - was eine große Einsparung an Emissionen bringen kann - fortgesetzt. Die Workshops wurden in bewährter Kooperation der Energieagentur Steiermark mit der BEST GmbH, dem Institut für Wärmetechnik der TU-Graz, der Landwirtschaftskammer Steiermark, dem Ofenhersteller Camina Schmid, der Innung der Rauchfangkehrer, den lokalen e5- und KEM-Managerinnen sowie den Workshopgemeinden veranstaltet. Eine Fortsetzung des Projektes für 2024 ist geplant
- Abgasmanipulation: Im Maßnahmenkatalog des Luftreinhalteprogramms 2019 soll im Bereich Motorentechnik die verpflichtende Kontrolle der Abgaswerte von LKWs im Realbetrieb auf der Straße durch Vorgaben sichergestellt werden. Die Emissionen von Luftschadstoffen aus dem LKW-Verkehr konnten durch die Flottenerneuerung in den vergangenen Jahren deutlich reduziert werden. Die nun durch erforderliche Abgasreinigungsanlagen entstehenden zusätzlichen Betriebskosten, (Verbrauch von AdBlue, zusätzlicher Wartungs- und Reparaturaufwand), versuchen manche LKW-Betreiber durch illegale Manipulationen am Abgasreinigungssystem oder durch den Betrieb von Fahrzeugen mit defektem Abgasreinigungssystem einzusparen, was die Erfolge in der Luftreinhaltung zum Teil zunichte macht. Der rechtlich verbindliche Nachweis von Defekten und Manipulationen ist allerdings derzeit ein großes Problem und kann bisher nur bei direkten LKW-Kontrollen mittels Diagnosegeräten und in Werkstätten durch aufwändige Prüfungen erfolgen. Bis für Fernerkundungsmessungen rechtssichere Rahmenbedingungen vorliegen muss eine zielgerichtete Vorauswahl der betroffenen Fahrzeuge erfolgen. Eine Möglichkeit ist das sogenannte „Plume Chasing"-Verfahren, eine robuste Methode für Abgasfernmessungen, die alle nötigen Bedingungen einhält. Um einerseits die Praxistauglichkeit dieser Methode zu verifizieren und andererseits Grundlagen für weitere Maßnahmen, wie die Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, wurde ein von der Abteilung 15 finanziertes
 Projekt in Zusammenarbeit der KFZ-Prüfstelle mit der Landespolizeidirektion, der ASFINAG und der Fa. Airyx durchgeführt.
Projekt in Zusammenarbeit der KFZ-Prüfstelle mit der Landespolizeidirektion, der ASFINAG und der Fa. Airyx durchgeführt. - Evaluierung der VBA (immissionsgesteuerte Verkehrsbeeinflussungsanlage): Auch im Jahr 2023 wurde der Betrieb der immissionsgesteuerten Verkehrsbeeinflussungsanlage gemäß den Vorgaben der VBA-Verordnung [BGBL 2007] evaluiert. Auf Basis der Verkehrsdaten und der Schalthäufigkeiten wurde für das gesamte VBA Gebiet im Evaluierungszeitraum eine Einsparung von 9,5 % der NOX-Emissionen der PKWs und 10,6 % der PM Auspuffemissionen der PKWs berechnet. Außerdem wurde der Kraftstoffverbrauch der PKWs um 4,6 % reduziert. Eine verstärkte Überwachung der Geschwindigkeitsbeschränkung könnte die Effizienz der VBA erhöhen. Um mögliche Grenzwertüberschreitungen im Jahresmittel gemäß IG-L bzw. der zukünftig geltenden Grenzwerte der neuen EU-Luftqualitätsrichtlinie festzustellen, wurden an von der VBA erfassten Autobahnkorridoren, in einem Gebietsstreifen von 100 m beiderseits der Straßenachse, für die Luftschadstoffe NO2, PM10 und PM2.5 Ausbreitungsmodellierungen mit dem Modellsystem GRAMM/GRAL durchgeführt. Trotz der Verringerung der Fahrzeugemissionen durch neue Motortechnologien und Flottenerneuerung ist eine durchgehende Einhaltung der derzeitig gültigen Grenzwerte nicht gegeben. Werden die Ergebnisse für das zukünftig einzuhaltende Limit von 20 µg/m³ NO2 als JMW betrachtet, so zeigt sich eine durchgehende Verletzung der Grenzwerte entlang der Autobahnen. Flexible Tempolimits können mit einer Reduktion der NO2-Immissionen von bis zu 1 µg/m³ im Jahresmittel einen wichtigen Beitrag zur Immissionsminderung leisten. Bei Verhängung eines permanenten 100ers, ließe sich der Effekt auf über 2,5 µg/m³ erhöhen. Dennoch wird mit Tempolimits allein nicht das Auslangen finden. (
 Evaluierungsbericht)
Evaluierungsbericht) - Emissionskataster Steiermark: Ein Schwerpunkt im Jahre 2023 war die Aktualisierung und Erweiterung des Emissionskatasters im Verkehrssektor. Als Ergänzung zum bereits erfassten hochrangigen Straßennetz wurde zur Berechnung der Emissionen auf Gemeindestraßen - in Gemeinden mit mehr als 1500 Einwohnern - eine Studie zur Ausweisung des ortsinternen Verkehrs auf öffentlichen Straßen in Auftrag gegeben [EFA 2023]. Datenbasis für das Modell ist einerseits eine statistische Abschätzung des gemeindespezifischen Verkehrs auf Basis sozioökonomischer Einflussfaktoren (abgestimmte Erwerbsstatistik 2019) und zum anderen die geographischen Detaildaten aus der GIP (Graphen-Integrations-Plattform) Steiermark. Mit Hilfe empirisch festgelegter Gewichtungsfaktoren erfolgte die Zuteilung der gesamten Gemeindefahrleistung auf einzelne Straßenkategorien und -abschnitte. Das Ergebnis der Studie ist eine Shapedatei, die den DTV (durchschnittlichen Tagesverkehr) als Anzahl der PKW-ähnlichen und LKW-ähnlichen Fahrzeuge, verortet als Linienquellen, darstellt. Die Berechnung der Emissionen erfolgte anschließend intern mit dem in Beanka integrierten Emissionsmodell NEMO [vers.5.0.6, ITnA, TU-Graz]
- Weiterentwicklungen numerischer Ausbreitungsmodelle: Der Schwerpunkt der naturwissenschaftlichen Entwicklungen lag in den vergangenen Jahren vor allem im Bereich der Anbindung des mesoskaligen Windfeldmodells GRAMM-SCI an globale Reanalysedaten (ERA5 Datensatz) des Europäischen Wetterdienstes ECMWF. Hochauflösende Strömungsberechnungen im komplexen Gelände, wie in der Steiermark, stellen nach wie vor eine wissenschaftliche Herausforderung dar. Modellberechnungen mit einer Gitterauflösung von etwa 1000 m sind typisch bei Forschungsprojekten. Bei den für die Steiermark durchgeführten Simulationen mit 200 m Auflösung sind noch viele offene wissenschaftliche Fragen zu lösen. Derzeit erfolgt eine Evaluierung inwieweit die simulierten Strömungsfelder für die Steiermark helfen könnten, Vorrangzonen für den Ausbau von Windkraftwerken auszuweisen.
- Geruchsemissionen aus Kompostanlagen: Im Rahmen der Überarbeitung der ÖNORM S 2209 wurde als Kooperationsprojekt der Referate Luftreinhaltung, Abfall- und Abwassertechnik, Chemie sowie des Umweltlaboratoriums eine Untersuchung zur Freisetzung von Geruchsstoffen und der Belastung der Sickerwässer von Kompostanlagen durchgeführt. Zur Bestimmung von Emissionsfaktoren von Geruchsstoffen für einzelne Prozessschritte (z.B. Aufsetzen und Umsetzen der Mieten, Wirkung von Abdeckungen) erfolgten sechs dynamische Fahnenbegehungen entsprechend EN 16841-2 bei einer oststeirischen Kompostanlage für biogene Abfälle. Zusätzlich wurden aus der Sickerwassergrube Proben entnommen und chemische und physikalische Analysen im Referat Umweltlaboratorium durchgeführt. Erwartungsgemäß wurden die höchsten Geruchsfreisetzungen während des Umsetzvorgangs ermittelt. Diese lagen in etwa um den Faktor 4 höher als die entsprechenden Emissionen der ruhenden Heißrotte ohne Vliesabdeckung. Das Minderungspotential der Vliesabdeckung lag bei rund 50% und stellt damit eine günstige und effektive Möglichkeit dar, Geruchsemissionen zu reduzieren.
- Software zur Erfassung der Emissionen aus tierhaltenden Betrieben:In den vergangenen Jahren war das Referat Luftreinhaltung als fachliche Beratungsstelle intensiv bei der Erarbeitung einer Rechenmethodik für Geruchszonen im Umkreis tierhaltender Betriebe im Zuge der Novellierung des Steiermärkischen Raumordnungs- [LGBL 2010] und Baugesetzes [LGBL 1995] eingebunden. Um die mittlerweile beschlossenen neuen gesetzlichen Anforderungen möglichst harmonisiert und verfahrensökonomisch umsetzen zu können, wurde für die Gemeinden eine Software (
 HofEr) zur Erfassung von Emissionen aus tierhaltenden Betrieben im Referat Luftreinhaltung entwickelt und kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Software erlaubt die lagetreue Eingabe von Kaminen, Fensteröffnungen oder offener Flächen (z.B. Güllelager) über eine GIS-Oberfläche unter Berücksichtigung der Tierarten und Bewirtschaftungsformen in einem Stall. Die entsprechenden Emissionen werden dabei automatisch berechnet und können mit einer einfachen Exportfunktion in das gesetzlich vorgeschriebene Ausbreitungsmodell GRAL zur Berechnung der Geruchszonen importiert werden
HofEr) zur Erfassung von Emissionen aus tierhaltenden Betrieben im Referat Luftreinhaltung entwickelt und kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Software erlaubt die lagetreue Eingabe von Kaminen, Fensteröffnungen oder offener Flächen (z.B. Güllelager) über eine GIS-Oberfläche unter Berücksichtigung der Tierarten und Bewirtschaftungsformen in einem Stall. Die entsprechenden Emissionen werden dabei automatisch berechnet und können mit einer einfachen Exportfunktion in das gesetzlich vorgeschriebene Ausbreitungsmodell GRAL zur Berechnung der Geruchszonen importiert werden - Zusammenstellung von Emissionsfaktoren für tierhaltende Betriebe: In engem Zusammenhang mit der Novellierung des Steiermärkischen Raumordnungs- und Baugesetzes stand auch die Überarbeitung der Richtlinie zur Ermittlung von Emissionen aus tierhaltenden Betrieben [A15 2023]. Auf Basis mehrerer Forschungsprojekte in Kooperation mit der HBLFA Raumberg-Gumpenstein, konnten neue Erkenntnisse bezüglich Geruchsemissionen aus tierhaltenden Betrieben gewonnen werden. Diese wurden in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer Steiermark und der HBLFA Raumberg-Gumpenstein für sämtliche praxisrelevanten Tierkategorien in einem neuen modulartigen Berechnungsmodell zusammengestellt, und in die Software HofEr zur automatisierten Berechnung der Geruchsemissionen implementiert. Dieser aktualisierte und hinsichtlich der betrachteten Tierarten wesentlich erweiterte Bericht löst damit die alten Faktoren aus dem Jahr 2018 ab. Er stellt den neuen Stand der Technik für die Beurteilung von Gerüchen, Ammoniak und PM10 in der Steiermark dar.
Hinweis:
Die Tabellen 31 & 32 mussten aufgrund eines Fehlers in der Auswertung bzw. Berechnung der Tabellen korrigiert werden.
Die Tabelle 41 musste aufgrund eines Rundungsfehlers aktualisiert werden.