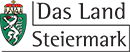Good-Practice-Beispiele
Der Klimawandel stellt für den Obstbau eine bedeutende Herausforderung dar. Die beobachtete Zunahme von Starkniederschlägen, Spätfrösten, Extremhagelereignissen, sowie von Pilzkrankheiten und Schadinsekten ist für die Obstbranche zu einem wirtschaftlichen Problem geworden. Für die Zukunft müssen deshalb Methoden entwickelt werden, die die Resilienz der Obstkulturen verbessern.
Im Frühjahr 2022 wurde zu Forschungszwecken an der Versuchsstation Obst- und Weinbau Haidegg eine Agri-PV-Anlage über Obstkulturen errichtet. Dieses Leuchtturmprojekt wurde zu zwei Dritteln aus Mitteln des Steirischen Klimafonds finanziert, das restliche Drittel wurde vom österreichischen Klima- und Energiefonds zur Verfügung gestellt. Die Versuchsanlage ist 5.000 m2 groß und wurde für obstbauliche Ansprüche optimiert; die verbauten Paneele sind zu 49 Prozent lichtdurchlässig.
In den bisherigen drei Vegetationsperioden konnten viele positive Ergebnisse erzielt werden. Im Frühjahr 2024 wurde ein guter Schutz vor Spätfrösten beobachtet. Die Paneele halten den Frost von den Blüten ab, wie ein Carport die Autoscheiben vor Vereisung schützt. Der Regenschutz durch die Paneele bewirkte einen wesentlich geringeren Befall durch Pilzkrankheiten. Eine Verzögerung der Reife, eine Verschlechterung der Ausfärbung und eine Reduktion der Fruchtzuckergehalte konnte bisher nicht beobachtet werden. Der Hagelschutz ist allerdings nicht genügend, weshalb eine Zusatzausrüstung mit Hagelschutznetzen installiert wird.
Hinsichtlich der Stromerzeugung gibt es auch positive Synergien. Da die Reihenrichtung in Obstkulturen vorzugsweise Nord/Süd gewählt wird - das gewährleistet eine ausgeglichene Belichtung der Baumkronen - ergibt sich automatisch eine Ost/West-Stromerzeugung. Das bedeutet geringere Mittagsspitzen und eine Steigerung der Stromproduktion an den Tagesrändern. Die Verdunstung der Blätter der Obstbäume kühlt die Paneele und verringert dadurch das Absinken der Spannung bei hohen Temperaturen. Die prognostizierte Jahresleistung in Höhe von 385.000 kWh wurde bisher um etwa fünf Prozent übertroffen.
Die beobachteten Synergieeffekte stimmen uns äußerst zuversichtlich. Deshalb planen wir gerade eine Erweiterung der Flächen mit dem Versuchsziel, durch Anpassungen bei der Baumerziehung die Pflanzengesundheit weiter zu verbessern und den Stromertrag zu steigern. Die Doppelnutzung Obst- und Stromproduktion ist für beide Sparten vorteilhaft.
A10 Land- und Forstwirtschaft

Bei der Konzeption des Busbahnhofes stand einerseits die Kundenfreundlichkeit mit kurzen Umsteigewegen und hoher Aufenthaltsqualität und andererseits eine nachhaltige Bauweise im Vordergrund. Die Überdachung mit einer Holzkonstruktion und einer Dachhaut aus bauwerksintegrierten PV-Modulen verbindet den nachhaltigen Baustoff Holz mit einer intelligent genutzten Dachhaut. Die vor Ort produzierte elektrische Energie wird über direkte Einspeisung bzw. Speicherung den Strombedarf des Busbahnhofes zu einem wesentlichen Teil abdecken. Überschüssige Energie wird darüber hinaus zu öffentlichen Gebäuden weiter geleitet.
Zur interaktiven Informationsseite:  hier
hier
Zum Folder:  hier
hier
Die Highlights des Busbahnhofes:
- Haltestellen für 6 Busse
- Ausstattung des Busbahnhofs für Kund:innen auf neuestem Stand der Technik (Monitore etc.)
- Barrierefreier Zugang zu allen Haltestellen
- Witterungsschutz für Fahrgäste durch eine attraktive Überdachung, welche zudem mit Photovoltaik-Panelen zur Energiegewinnung ausgestattet ist
- WC-Anlagen
- Unterirdisches Regenwassersammelbecken für nachhaltige Brauchwassernutzung wie z. B. Blumen gießen im gesamten Ortsgebiet
- Multimodale Verknüpfung durch Einbindung in das Radwegenetz mit Fahrradabstellanlagen
- Trinkbrunnen und Sitzmöglichkeiten
- Umfassender Anrainerschutz durch dichte Bepflanzungen und Lärmschutzwände
- Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Neugestaltung des Kreuzungsbereichs
- Berücksichtigung der Anforderungen der Feuerwehr

Die Versuchsstation für Spezialkulturen Wies ist Teil der Abteilung 10 - Land- und Forstwirtschaft, Referat Pflanzengesundheit und Spezialkulturen.
Hier hat man sich nicht nur den Fragestellungen von Gemüsebau und Zierpflanzen verschrieben, es werden auch unterschiedliche biologische Arznei- und Gewürzpflanzen angebaut, die anschließend getrocknet und zu hochwertigen Teemischungen sowie Gewürzen und Gewürzmischungen verarbeitet werden.
Da das Betreiben der Gewächshäuser und der Verarbeitungsprozess bei der Kräutertrocknung viel Energie benötigen, wurde im Jahr 2023 eine solarthermische Anlage mit einer Fläche von knapp 400 m² zur Wärmegewinnung errichtet sowie eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von etwa 30 kWp installiert.
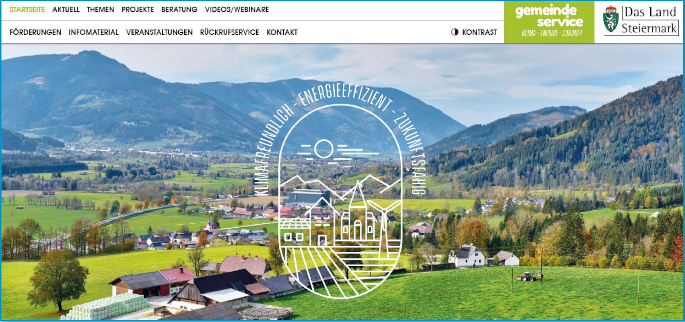
Das Gemeindeservice ist ein Angebot des Landes Steiermark und bietet allen steirischen Gemeinden übersichtliche Informationen und einfach aufbereitetes Wissen zu Energie, Energieeffizienz, Klimaschutz und Klimawandelanpassung.
Zwischenergebnisse 2021-2023:
- 3 Gemeindekonferenzen mit 124 Gemeinden
- Aufbau einer gemeindespezifischen Datenbank
- Einrichtung einer Webplattform
 www.gemeindeservice-stmk.at
www.gemeindeservice-stmk.at - Durchführung von Gemeindetischen mit 179 Gemeinden
- Gemeindeberatung für 157 Gemeinden
- Webinare zu Klima- und Energiethemen mit 121 Gemeinden

Beim Karmeliterhof wurden im Jahr 2023 mit Mitteln des Klimafonds Teile der Fassade und der Dachterrassen im Ausmaß von rd. 980 m2 in Form von Vertikalbegrünungen begrünt sowie Begrünungsmaßnahmen in der sogenannten Schmalen Gasse durchgeführt. 2024 folgten weitere Fassadenbegrünungen im Innenhof, wodruch eine Beschattung und Kühlung des Gebäudes erfolgen soll.
Vertikale Begrünung der Fassade - Begrünungssystem:
- Stahlkonstruktion
- Vertikale, lineare Seilsysteme
- Pflanztröge
- Kletterpflanzen/Mischbegrünung
- 100% Begrünung
- Beschattung und Kühlung des Gebäudes
Begrünung mit:
- Wisteria frutescens
- Amethyst Falls
- Clematis orientalis
- Bill Mackenzie
- Akebia quinata
Bis zum Jahr 2030 soll die Klimaneutralität in der Landesverwaltung erreicht werden (KLIM 2030), das bedeutet aber nicht nur die eigenen Energieverbräuche, Gebäude und den Fuhrpark zu betrachten, sondern auch alle Landesbeteiligungen in den Prozess miteinzubeziehen. Große Unternehmen wie z.B. die Energie Steiermark AG handeln bereits nach entsprechenden internen Zielvorgaben und dokumentieren Fortschritte in Nachhaltigkeitsberichten.
Damit aber auch vor allem kleinere Landesbeteiligungen, die erstmalig mit dieser Thematik konfrontiert sind, dieses Ziel erreichen können, bedarf es finanzieller Unterstützung und fachlicher Expertise. Insgesamt sollen 16 Landesbeteiligungen beim Start des Prozesses in Richtung Klimaneutralität unterstützt werden. Die Erstellung einer Treibhausgasbilanz und die konkrete Maßnahmenplanung sowie in weiterer Folge die Umsetzung der Maßnahmen und ein entsprechendes Monitoring sind dabei die wesentlichen Schritte.
Seit 1982 verbindet das NAZ mit einem dualen Ausbildungsmodell Lehre und Spitzensport. Die über 400 Sportler:innen, die hier eine Lehre begonnen haben, konnten bereits 117 Medaillen bei Großveranstaltungen gewinnen, davon 17 bei Olympischen Spielen und 20 bei Weltmeisterschaften.
Auf dem Dach des NAZ-Campusgebäudes wird nun eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 54 kWp errichtet. Der dabei produzierte Strom wird zur Deckung des Eigenbedarfs genutzt. Unter anderem soll die durch die Sonne gewonnene Energie zur Warmwasseraufbereitung verwendet und zwei E-Ladestationen betrieben werden. Etwaige Stromüberschüsse werden ins öffentliche Netz eingespeist. Damit leistet das NAZ einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.
Zum Nordischen Ausbildungszentrum Eisenerz:  hier
hier
In der Steiermark bestehen über 600 Nah- und Fernwärmenetze, wobei die Wärme größtenteils durch Biomasse aufgebracht wird. Weitere erneuerbare Wärmequellen wie Solarthermie, oder industrielle Abwärme sind ebenfalls zunehmend im Erzeugungsmix zu finden. Jedoch spielt Erdgas, vor allem im urbanen Bereich, immer noch eine wesentliche Rolle. Im Sinne der Dekarbonisierung kommt gerade jenen Netzen, die einen hohen Anteil an fossilen Energieträgern einsetzen, eine bedeutende Aufmerksamkeit zu.
Um eine nachhaltige, effiziente und sichere Energieversorgung zu garantieren, ist eine zuverlässige Datenbasis unerlässlich. Daher bedarf es einer zentralen Fernwärmedatenbank, um die Erfassung technischer und wirtschaftlicher Fernwärme-, Heizwerks- und Wärmeerzeugerdaten, sowie eine entsprechende statistische Auswertung und ein Monitoring des Fernwärmenetzausbaus zu gewährleisten.
Die Datenbank wird eine wichtiges Instrument für Entscheidungsträger:innen sein und soll es ermöglichen die enthaltenen Werte nach bestimmten Parametern automatisch auszuwerten. Ebenso wird sie essentiell sein, um im Energielenkungsfall rasche und zielführende Handlungen setzen zu können. Zudem soll eine GIS-Schnittstelle die im Digitalen Atlas Steiermark dargestellten Netzpläne verknüpfen und mit Hintergrundinformationen ausstatten, was z.B. für die Energieraumplanung oder zur effizienteren Wohnbau- und Energieförderungsabwicklung von großer Bedeutung sein wird.