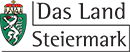|
L Seitenanfang
- Labile Schichtung:
sie ist in der Atmosphäre dann vorhanden, wenn die Abnahme der Temperatur größer als 1°C pro 100 m ist. Die Labilität hängt stark mit der Luftfeuchtigkeit zusammen und begründet Wetterphänomene wie Gewitter.
- Lösemittel = Lösungsmittel:
sind Stoffe, die andere auf physikalischem Weg zur Lösung bringen können. Das heißt, dass der gelöste Stoff nicht verändert wird. Das gängigste und für den Ablauf biologischer Prozesse entscheidende Lösungsmittel ist Wasser. Aber auch Kohlenwasserstoffverbindungen werden häufig als Lösungsmittel (für Lacke, Klebstoffe, Schmutz, ...) eingesetzt.
- Luftfeuchtigkeit:
ist die Menge des in der Luft enthaltenen Wasserdampfs. Die absolute Luftfeuchtigkeit gibt die insgesamt vorhandene Wassermenge in g/m3 an, die relative Luftfeuchtigkeit gibt das Verhältnis der maximal möglichen zur tatsächlichen Luftfeuchte an.
- Luftgüteüberwachungssystem:
dieses umfasst die Luftgüteüberwachungszentrale sowie die Gesamtheit aller automatischen Messstationen (das forstrelevante Messnetz, die Messnetze in Ballungsräumen, das emittentenbezogene Messnetz, die mobilen Messcontainer für lokale Messungen) sowie die integralen Messungen.
- Luftverschmutzung:
Gesamtbegriff für die Verunreinigung der Atmosphäre mit einer Vielzahl verschiedener chemischer Substanzen, die umwelt- und gesundheitsgefährdend sein können.
M Seitenanfang
- MAK-Wert:
Abkürzung für maximale Arbeitsplatzkonzentration. Ein MAK-Wert ist laut Definition der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) die höchstzulässige Konzentration eines Arbeitsstoffes als Gas, Dampf oder Schwebstoff in der Luft am Arbeitsplatz, die nach dem gegenwärtigen Stand der Kenntnisse auch bei wiederholter und langfristiger, in der Regel täglich achtstündiger Exposition, jedoch bei Einhaltung einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 40 Stunden im allgemeinen die Gesundheit der Beschäftigten nicht beeinträchtigt und diese nicht unangemessen belästigt.
- Meteorologie:
Physik der Atmosphäre mit verschiedenen wissenschaftlichen Teilgebieten (z.B. Klimatologie, Synoptik, u.a.).
- Mikrogramm (µg):
Der millionste Teil eines Gramms (10-6g)
- Milligramm (mg):
Der tausendste Teil eines Gramms (10-3g)
O Seitenanfang
- Ozon:
ist ein reaktives, leicht stechend riechendes Gas mit Molekülen aus je drei Sauerstoffatomen, chem. Formel O3. In den unteren Schichten der Atmosphäre kommt sogenanntes "bodennahes Ozon" als Spurengas natürlich vor, wird darüber hinaus bevorzugt in den Sommermonaten mit starker Sonneneinstrahlung als Luftschadstoff aus verschiedenen Vorläufersubstanzen (Kohlenwasserstoffe, Stickstoffoxide, Kohlenmonoxid) gebildet oder entsteht u.a. in Kopierern oder Laserdruckern. Aufgrund seiner starken Oxidationswirkung kann Ozon als Desinfektionsmittel (z.B. Trinkwasserentkeimung) verwendet werden, ist aber bei hohen Konzentrationen auch gesundheitsschädigend (Lungenerkrankungen, Atembeschwerden, Schleimhautreizungen, Übelkeit, Schwächung des Immunsystems). Aufgrund dieser Gefährdung wurde von der Akademie der Wissenschaften bereits im August 1989 ein Vorsorgegrenzwert in Höhe von 0,120 mg/m3 (als Halbstundenmittelwert) veröffentlicht. Das Ozongesetz aus dem Jahr 1992 fixiert folgende Warnstufen (jeweils als Dreistundenmittelwert): Vorwarnstufe = 0,200 mg/m3, Warnstufe 1 = 0,300 mg/m3, Warnstufe 2 = 0,400 mg/m3.
- Ozondatenverbund:
Zusammenschluss aller Immissionsmessnetzbetreuer Österreichs in einem EDV-Netz
- Ozonloch:
so bezeichnet man eine extreme Störung der chemischen Zusammensetzung der Stratosphäre, bei der es zu einer großräumigen Vernichtung der Ozonmoleküle kommt. Den stärksten Ozonabbau findet man über der Antarktis, wobei in Höhen zwischen 15 und 20 km bis zu 90 % des Ozons (im antarktischen Winter 1989) verschwinden und ein "Loch" im UV-Schutzschild der Ozonschicht entsteht. Am Nordpol wurde bisher ein maximaler Ozonabbau von etwa 20 % registriert. Humanpathogene Folgen der erhöhten UV-Einstrahlung sind Hautkrebs und Grauer Star.
- Ozonschicht:
in der Stratosphäre wird in einer Höhe von etwa 10 bis 50 km durch die UV-Strahlung der Sonne die sog. Ozonschicht gebildet. Sie bewirkt, dass die Temperatur in dieser Höhe von etwa -50°C wieder bis auf etwa 0°C zunimmt und schützt die Erdoberfläche vor der UV-Strahlung. Im Äquatorbereich ist die Ozonschicht dicker als an den Polen. Durch Luftschadstoffe wie chlorierte Kohlenwasserstoffe (FCKW) oder Chlorfluorkohlenstoffe (CFK) kommt es zum Ozonabbau, seit 1970 weltweit um ca. 5 %.
- Ozonüberwachungsgebiet:
nachdem Ozonbelastungen immer großräumig auftreten, wurde Österreich gemäß § 1 des Ozongesetzes (BGBl. Nr. 210/1992) in 7 Ozonüberwachungsgebiete eingeteilt
P Seitenanfang
- Passivsammler:
Vorrichtung zur Sammlung von Luftschadstoffen, die ohne aktive Ansaugung der Probe (Pumpe) arbeitet. Für die Probenahme wird der Passivsammler der Umgebungsluft ausgesetzt. Der Stofftransport erfolgt durch Diffusion zu einer Sammelschicht (z.B. Aktivkohle).
- Photochemischer Smog:
(= Sommersmog, "Los-Angeles-Smog"). Im Unterschied zum Wintersmog, bei dem Verbrennungsprodukte und Stäube direkt gesundheitsschädigend wirken, wird die schädigende Wirkung des Sommersmogs durch Photooxidantien verursacht. Diese bilden sich unter Einfluss von Sonnenstrahlung aus Vorläufersubstanzen und führen schon bei niedrigen Konzentrationen zu Schleimhautreizungen und Lungenbeeinträchtigungen sowie zu Schäden bei Pflanzen. Vor allem Industrieregionen und Ballungsräume mit einem starken Verkehrsaufkommen sind Sommersmog-gefährdet. Zu den Photooxidantien zählen z.B. Ozon und PAN (Peroxyacetylnitrat).
- Photooxidantien:
bilden sich aus Stickstoffoxiden und Kohlenwasserstoffen und Sauerstoff unter dem Einfluss intensiver Sonnenstrahlung. Zu diesen gehören Ozon, Peroxyacetylnitrat (PAN), Salpetersäure und sonstige Reaktionsprodukte, die oxidierende Eigenschaften haben. Den Photooxidantien wird einerseits eine Mitverantwortung für die weltweit auftretenden Waldschäden zugesprochen.
- Ppm:
(parts per million = ein millionstel Teil). Anteil eines Stoffs im Vergleich zu einer Million Teilen des Gesamtgemisches.
- Ppb:
(parts per billion = ein milliardstel Teil). Anteil eines Stoffs im Vergleich zu einer Milliarde Teilen des Gesamtgemisches.
Q Seitenanfang
- Qualitätssicherung:
in allen Details nachvollziehbare "Entstehung" eines Mess- bzw. Mittelwertes
R Seitenanfang
- Radikal:
chemische Bezeichnung für elektrisch neutrale Atome oder Atomgruppen, die ein oder mehrere freie Elektronen besitzen und sehr reaktionsfreudig sind.
- Reinluftgebiet:
Unscharfe Bezeichnung für Regionen, in denen die lufthygienischen Beeinträchtigungen durch primäre Luftverschmutzungen im Vergleich zu dicht besiedelten Gebieten gering ist. Reinluftgebiete können aber während der Sommermonate durch erhöhte Ozonwerte beeinträchtigt werden.
- Ruß:
Eine Erscheinungsform des Kohlenstoffs, die sich bei unvollständiger Verbrennung bzw. thermischen Spaltung von dampfförmigen kohlenstoffhaltigen Substanzen bildet, in unerwünschter Weise z.B. bei der Verbrennung von Dieselkraftstoff in schlecht eingestellten Motoren oder als Schornsteinruß an Feuerstellen usw. Ruß ist ein sehr feines, tiefschwarzes bis graues Pulver, das je nach Bildungsprozess 85 - 98% Kohlenstoff enthält. Solche Produkte können nicht unerhebliche Anteile an karzinogenen polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen enthalten, die man schon früh für die Entstehung der sogenannte Schornsteinfeger- oder Rußwarze (seit 1755 als "Berufskrankheit" erkannt!) verantwortlich gemacht hatte.
S Seitenanfang
- Sauerstoff:
auf der Erde das häufigste chemische Element mit dem chemischen Zeichen O. Bei Normalbedingungen farb- und geruchloses Gas, welches als O2-Molekül oder kurzzeitig als O3-Molekül auftritt. Sauerstoff wird von grünen Pflanzen durch Photosynthese gebildet (z.B. pro m2 tropischer Regenwald 1,9 bis 3,8 m3 O2 pro Jahr) und von Menschen und Tieren zur Atmung benötigt (bei einem Sauerstoffgehalt der Atemluft von unter 3 Vol-% tritt Erstickungstod ein). Fast alle Elemente reagieren (zum Teil heftig) mit Sauerstoff.
- Saurer Regen:
Sammelbezeichnung für Niederschläge, die mit schwefeligen und salpetrigen Säuren kontaminiert sind. Das Schwefeldioxid als Basis für die Schwefelsäure stammt meist aus der Verbrennung von Erdölprodukten und Kohle, die Stickstoffoxide als Basis für die Salpetersäure stammen hauptsächlich aus dem Kfz-Verkehr. Der saure Regen ist verantwortlich für Waldschäden und die Übersäuerung von Oberflächengewässern (vor allem in Skandinavien) und von Böden.
- Schwefeldioxid:
farbloses, stechend riechendes Reizgas mit der chem. Formel SO2. Es entsteht natürlich durch vulkanische Emissionen sowie durch Oxidation von Schwefel, insbesondere bei der Verbrennung von Erdölprodukten und Kohle. Schwefeldioxid war bis zu Beginn der 90iger Jahre auch bei uns einer der Hauptfaktoren der Luftverschmutzung und hauptverantwortlich für den Sauren Regen. Beim Menschen reizt es die oberen Atemwege und die Bindehäute der Augen, bei höheren Konzentrationen führt es zu schweren Lungenerkrankungen (Asthma, Lungenentzündung, Bronchialkatarrh). Auf Pflanzen wirkt Schwefeldioxid mit direkten Verätzungen durch Säurebildung, mit einer Schädigung des Assimilationsgewebes und einer Störung der Keimfähigkeit, Schwefeldioxidkonzentrationen erreichen im Winterhalbjahr ihr Maximum. Hauptemittenten sind industrielle und gewerbliche Betriebe sowie der Hausbrand.
- Schwefelwasserstoff:
farbloses, nach faulen Eiern riechendes, sehr giftiges Gas mit der chem. Formel H2S. Es entsteht in der Natur bei der Zersetzung von schwefelhaltigen Aminosäuren durch Fäulnisbakterien und findet sich in vulkanischen Gasen und Schwefelquellen. Anthropogen bedingte Emissionen gibt es bei Kläranlagen, Güllegruben sowie in der Mineralöl- und Zellstoffindustrie.
- Schwermetalle:
Bezeichnung für Metalle mit einer Dichte über 3,5 bis 5 g/cm3. Da viele Schwermetalle (z.B. Blei, Quecksilber, Kupfer, Zink, Chrom, Cadmium, Cobalt, Nickel) nicht nur in elementarer Form (als Staub) sondern besonders in Form ihrer löslichen Salze stark toxisch wirken, wird deren Anreicherung in der Natur große Beachtung zu schenken sein. Es gibt lebensnotwendige (essentielle) Schwermetalle (z.B. Zink, Eisen, Mangan, Kupfer) und giftige Schwermetalle (z.B. Blei, Cadmium, Quecksilber). Die Quellen für die Schwermetall-Immissionen sind teils natürlichen Ursprungs (Vulkane, Verwitterung), teils anthropogen als Folge der Industrialisierung (Rauchgase, Fabrikabwässer, Sondermüll, Autoabgase).
- Smog:
der Begriff ist ein Kunstwort, welches sich aus den beiden englischen Worten "smoke" (Rauch) und "fog" (Nebel) zusammensetzt. Unterschieden werden Sommersmog (photochemischer Smog) und Wintersmog.
- Smogmessnetz:
aufgrund der hohen Stickstoffdioxidkonzentrationen im Winter 1988/89 wurde im Raum Graz das sog. Smogmessnetz installiert. In 6 stationären Luftgütemessstationen erfolgt die Messung der smogrelevanten Luftschadstoffe sowie eine permanente Erfassung der wichtigsten meteorologischen Daten.
- Spurengase:
Neben den Hauptgasen der Erdatmosphäre (Stickstoff, Sauerstoff, Argon und Kohlendioxid) gibt es eine Vielzahl von Spurengasen, die alle in ganz geringen Konzentrationen vorkommen, aber entscheidenden Einfluss auf die chemischen Prozesse in der Lufthülle haben. die wichtigsten Spurengase in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit: Wasserdampf (H2O), Neon (Ne), Helium (He), Krypton (Kr), Methan (CH4), Wasserstoff (H2), Distickstoffoxid (N2O), Chlorwasserstoff (HCl), Fluorwasserstoff (HF), Methylchlorid (CH3Cl). Manche entstehen durch natürliche Prozesse wie Gewitter, Vulkanismus oder biogenen Abbauvorgängen in den Meeren.
- Staub:
ist die disperse Verteilungen fester Stoffe in Gasen, entstanden durch mechanische Prozesse oder durch Aufwirbelung. Staub gehört zusammen mit Rauch und Nebel zu den Aerosolen. Bei Stäuben, die aus Verbrennungsprozessen entstehen, spricht man von Rauch. Ihre Korngröße liegt meist unter 1µm, bis in Größenordnungen von 0,01 µm. Ein nennenswertes Sedimentieren ist erst bei Teilchen >10 µm möglich. Die Sinkgeschwindigkeit eines kugelförmigen Teilchens von 10 µm Durchmesser u. der Dichte 1 g/cm3 in ruhender Luft ist etwa 3 mm/s. Den Korngrößenbereich <10 µm bezeichnet man als Feinstaub. Atmet der Mensch Staub ein, dann werden Teilchen oberhalb 10 µm bereits überwiegend von den Nasenschleimhäuten abgefangen, während kleinere Partikel bis in die Bronchien vordringen. Teilchen unterhalb 5 µm dringen zunehmend bis in feinste Lungenwege, den sog. Alveolen, vor, in denen der Stoffaustausch stattfindet. Auf Grund der großen Oberfläche oder durch die Entstehung können an Feinstaub Schwermetalle und Kohlenwasserstoffe angelagert sein. Hauptemittenten sind der Hausbrand und die Betriebe.
- Staubinhaltsstoffe:
Auf Grund der großen Oberfläche können inerte Stäube Schadstoffe (z.B. Schwermetallverbindungen, Schwefeldioxid, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) adsorbieren und diese so in hohen Konzentrationen in den Körper gelangen. Besonders in Industriegebieten weist der Staub hohe Belastungen an gesundheitsgefährdenden Substanzen auf. Das Auftreten von Atemwegserkrankungen (z.B. Pseudokrupp bei Kindern) wird auf diese Staubinhaltsstoffe zurückgeführt.
- Stickstoff:
Hauptbestandteil der Atmosphäre mit dem chemischen Zeichen N. Bei Normalbedingungen farb- und geruchloses Gas, welches als N2-Molekül vorkommt. Dieses sehr reaktionsträge Gas reagiert erst bei sehr hohen Temperaturen (über 1000°C) mit Sauerstoff unter der Bildung von Stickstoffoxiden. Stickstoff findet sich in gebundener Form in Ammonium-, Nitrat-, Nitrit- und Amidverbindungen. Er ist essentieller Bestandteil aller Eiweißkörper (Aminosäuren) und daher für alles Lebendige (Grundsubstanz für die pflanzliche Entwicklung).
- Stickstoffdioxid:
bräunliches, stechend riechendes Gas mit der chemischen Formel NO2. Es entsteht natürlich durch Gewitter, durch Oxidation von Stickstoff bei der Verbrennung von Erdölprodukten und Kohle oder durch die thermische Reaktion von Stickstoffmonoxid mit Sauerstoff. Stickstoffdioxid ist einer der Hauptfaktoren der Luftverschmutzung und mitverantwortlich für den Sauren Regen. Beim Menschen reizt es schon bei geringer Konzentration die oberen Atemwege und die Bindehäute der Augen, bei höheren Konzentrationen führt es zu schweren Lungenerkrankungen (Asthma, Lungenentzündung, Bronchialkatarrh) bis zum Atemstillstand. Auf Pflanzen wirkt Stickstoffdioxid mit einer Bleichung und vorzeitigen Alterung der Blätter und durch Verätzung durch die Bildung von Salpetersäure. Stickstoffdioxid ist im Sommer eine wichtige Vorläufersubstanz für Photooxidantien, im Winterhalbjahr erreichen die Immissionen allerdings ihr Maximum, meist begünstigt durch Inversionen. Hauptemittent für Stickoxide ist der Straßenverkehr.
- Stickstoffmonoxid:
farbloses, erst in höheren Konzentrationen stechend riechendes Gas mit der chemischen Formel NO. es entsteht bei der Verbrennung von Erdölprodukten und Kohle und oxidiert in der Atmosphäre zu Stickstoffdioxid. Hauptemittent ist der Kfz-Verkehr. Stickstoffmonoxid ist in der Luft nie in so hohen Konzentrationen vorhanden, dass Menschen, Tiere oder Pflanzen gefährdet werden.
- Stratosphäre:
Schließt an die Troposphäre an und reicht von 10 bis in etwa 50 km Höhe. In ihr befindet sich die Ozonschicht.
T Seitenanfang
- Transmission:
ist die Ausbreitung von emittierten Luftschadstoffen in der Atmosphäre. Während des Transports erfolgt eine Verdünnung und Veränderung der Schadstoffe. Die Klimaelemente haben hier einen wesentlichen Einfluss.
- Treibhauseffekt:
die auf der Erdoberfläche auftreffenden Sonnenstrahlen werden zum Teil absorbiert, reflektiert und auch als langwellige Strahlung in die Atmosphäre rückgestrahlt. Diese Rückstrahlung ist abhängig vom Gehalt der Atmosphäre an Wasserdampf, Kohlendioxid und anderen Spurengasen. Durch den Rückhalt eines Teiles der Rückstrahlung in der Lufthülle hat sich eine mittlere Atmosphärentemperatur von ca. 15°C eingestellt (= natürlicher Treibhauseffekt). Steigt nun die Konzentration der Gase an, erhöht sich auch das Gegenstrahlungsvermögen und dadurch die Atmosphärentemperatur. Durch unkontrollierte Verbrennung fossiler Energieträger wird gebundener Kohlenstoff mobilisiert und der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre steigt an, was eine globale Erwärmung zur Folge hat (= anthropogener Treibhauseffekt). Bis zum Jahr 2100 wird eine Erhöhung der bodennahen Weltmitteltemperatur um bis zu 5°C erwartet.
- Treibhausgase:
(klimarelevante Spurengase). Sie tragen unterschiedlich zum Treibhauseffekt bei und verweilen zwischen mehreren Monaten bis zu knapp 200 Jahren in der Atmosphäre. Die wichtigsten Gase sind Kohlendioxid, Methan, Fluorchlorkohlenwasserstoffe, troposphärisches Ozon sowie Distickstoffmonoxid (Lachgas). Anthropogene Quellen sind die Verbrennung fossiler Brennstoffe (Kohle, Erdöl, Erdgas), Verkehrsemissionen, Treibgase, übermäßiger Düngemitteleinsatz, Viehzucht, Reisanbau und Entwaldung.
- Troposphäre:
sie ist die unterste, wetterwirksame Schicht der Atmosphäre und reicht bis durchschnittlich 10 km Höhe. Sie wird durch Windströmungen intensiv vertikal durchmischt und durch Regen ausgewaschen (Reinigungsprozess). Die Troposphäre ist über dem Äquator bedeutend dicker (17 km) als über den Polen (8 km) und enthält etwa 2/3 der Atmosphärenmasse. Die Zunahme klimarelevanter Spurengase (z.B. Kohlendioxid) in der Troposphäre verändert die Strahlungsbilanz und führt zu einer Erwärmung (= Treibhauseffekt).
U Seitenanfang
- Umweltdetektive unterwegs:
in den Jahren 1995 und 1996 in der Steiermark als Kooperationsprojekt der Fachabteilung Ia des Amts der Stmk. Landesregierung und der ARGE Umwelterziehung Graz durchgeführte Kampagne zur Hebung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung. Ziel war die intensive Auseinandersetzung mit den Problemkreisen Luftreinhaltung, Lärmschutz und Gewässerreinhaltung, wobei Schulen, Lehrer, Lehrerinnen und Vereine angesprochen wurden. Praxisseminare in verschiedenen steirischen Regionen sowie die Erarbeitung von Publikationen (Lehrerhandreichungen, Info-Folder) und von Detektiv-Koffern sollen zu Projekten auf Gemeindeebene führen, bei denen die Umweltsituation ganzheitlich betrachtet wird.
- Unser Lebensmittel Luft:
Seit dem Jahre 1990 in der Steiermark als Kooperationsprojekt der Fachabteilung Ia des Amts der Stmk. Landesregierung und der ARGE Umwelterziehung Graz durchgeführte Kampagne zur Hebung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung. Ziel war die intensive Auseinandersetzung mit dem Problemkreis der Luftverschmutzung, wobei speziell Multiplikatoren im schulischen Bereich angesprochen wurden. Mehrere Dutzend Seminare und Vorträge wurden in allen Regionen der Steiermark durchgeführt, darüber hinaus wurden diverse Publikationen (Lehrerhandreichungen, Info-Folder, Zeitschriften) direkt an Zielgruppen verteilt.
- UV-Strahlung:
(= ultraviolette Strahlung). Sie gehört zur elektromagnetischen Strahlung und besitzt eine Wellenlänge zwischen 180 und 400 nm. Die UV-Strahlung schließt sich im Spektrum an das energiereiche (violette) Ende des sichtbaren Lichts an. Die Wirkung der Strahlung ist abhängig von der Wellenlänge, man unterscheidet: UVA (400 - 320 nm), UVB (320 - 280 nm) und UVC (280 - 180 nm). UVA- und UVB-Strahlung gelangen bis auf die Erdoberfläche, die UVC-Strahlung wird in der Ozonschicht absorbiert. UVA ist für die Hautbräunung verantwortlich, UVB bräunt ebenfalls die Haut und aktiviert Atmung, Kreislauf und Stoffwechsel, bewirkt in höheren Dosen allerdings Sonnenbrand. UVB ist wichtig für Kinder zur Synthese des Vitamin D. UV-bedingte gesundheitliche Folgen durch übermäßiges Sonnenbaden sind vorzeitiges Altern der Haut, Hautkrebs, Grauer Star und Störungen des Immunsystems. die UV-Strahlung wird durch normales Fensterglas weitgehend absorbiert.
V Seitenanfang
- Verbrennung:
Bezeichnung für die chemische Reaktion, bei der sich ein chemisches Element schnell und unter Wärmeabgabe mit Sauerstoff verbindet (z.B. der Kohlenstoff in der Kohle verbrennt zu Kohlendioxid, der Schwefel zu Schwefeldioxid). Viele Brennstoffe benötigen eine bestimmte Entzündungstemperatur, damit die Verbrennungsreaktion einsetzen kann. Bei der Verbrennung von fossilen Brennstoffen und Biomasse entstehen Kohlendioxid, verschiedene gasförmige Luftschadstoffe, Staub, Ruß (CO) und Kohlenwasserstoffe (CxHy) bezeichnet, die vor allem in den Sommermonaten bei hoher Strahlungsmenge und höheren Lufttemperaturen zur Bildung des photochemischen Smogs führen. Hauptemittent dieser Substanzen ist der Kfz-Verkehr.
W Seitenanfang
- Wetter:
Bezeichnung für den augenblicklichen Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort. Das Wetter ändert sich kurzfristig und fortlaufend.
- Wind:
meist horizontale, z.T. durch starke vertikale Temperaturunterschiede auch vertikal verlaufende Luftströmung. Lufthygienisch bedeutend sind Talaufwärts- und -abwärtswinde, Fallwinde (Föhn) und Starkwindereignisse (Sturm) sowie Windrichtung und Windgeschwindigkeit (= Windstärke, wird in m/s oder km/h gemessen). Luftschadstoffe werden je nach vorherrschender Windrichtung verfrachtet, mit zunehmender Windgeschwindigkeit werden sie besser durchmischt. Starkwinde wirbeln aber viel Staub auf und verschlechtern somit die Luftsituation. bei störungsfreiem Schönwetter bildet sich das Tal-Berg-Windsystem aus: tagsüber strömt die Luft aus dem Vorland die Täler aufwärts (durch die Erwärmung werden die bodennahen Luftschichten leichter und steigen auf), in den Nacht- und Morgenstunden kehrt sich die Windrichtung um und es kommt zu einer talabwärts gerichteten Strömung (die am Berg erkalteten Luftmassen sinken an den Berghängen ins Tal).
- Witterung:
Bezeichnung für eine in sich geschlossene, zusammenhängende Folge von einzelnen Wetterabschnitten während einer bestimmten Zeitspanne, also für bestimmte Phasen eines im Grundcharakter gleichen Wettertypus, die sich aber deutlich von anderen Abschnitten unterscheiden.
|